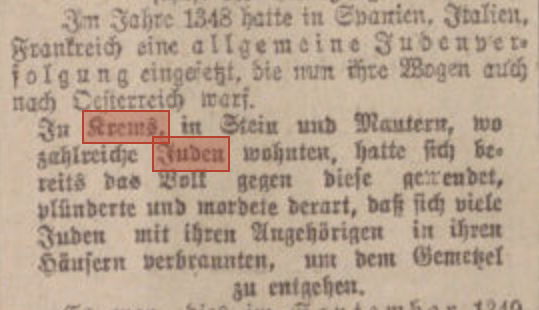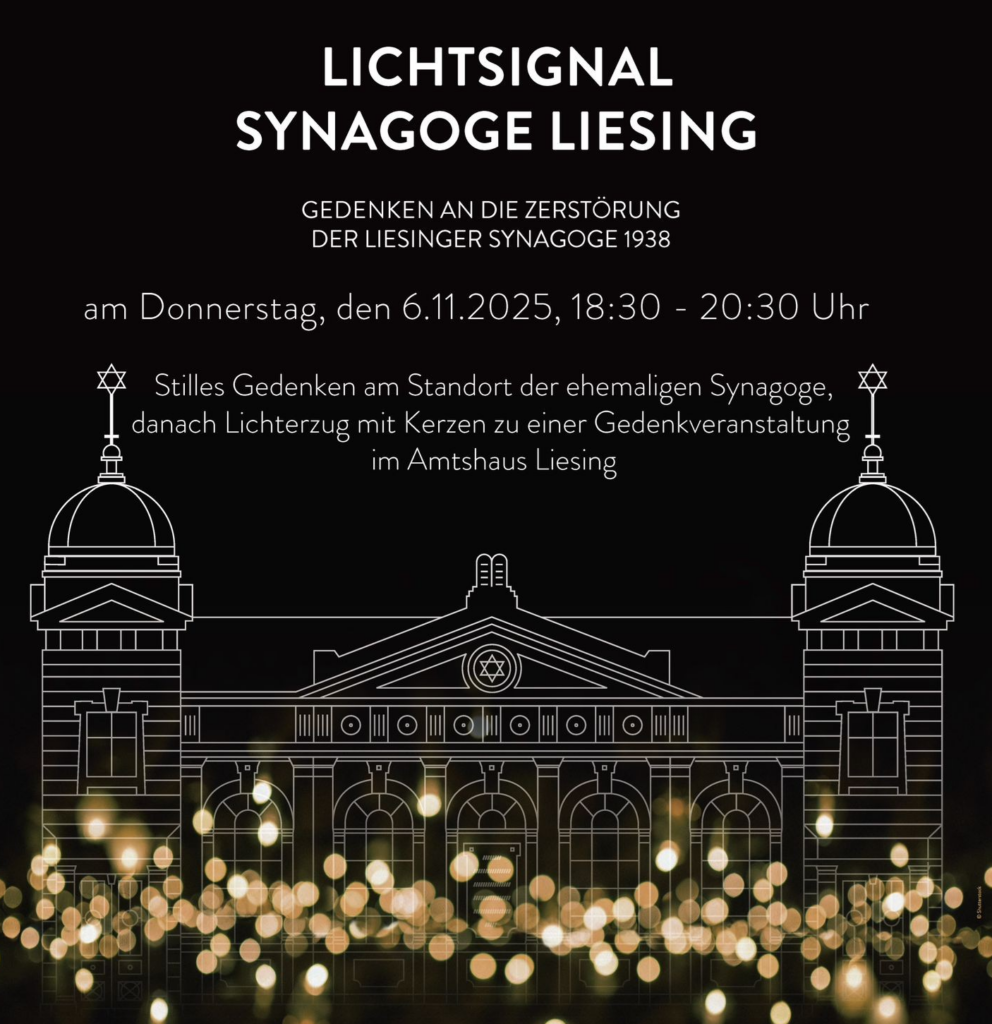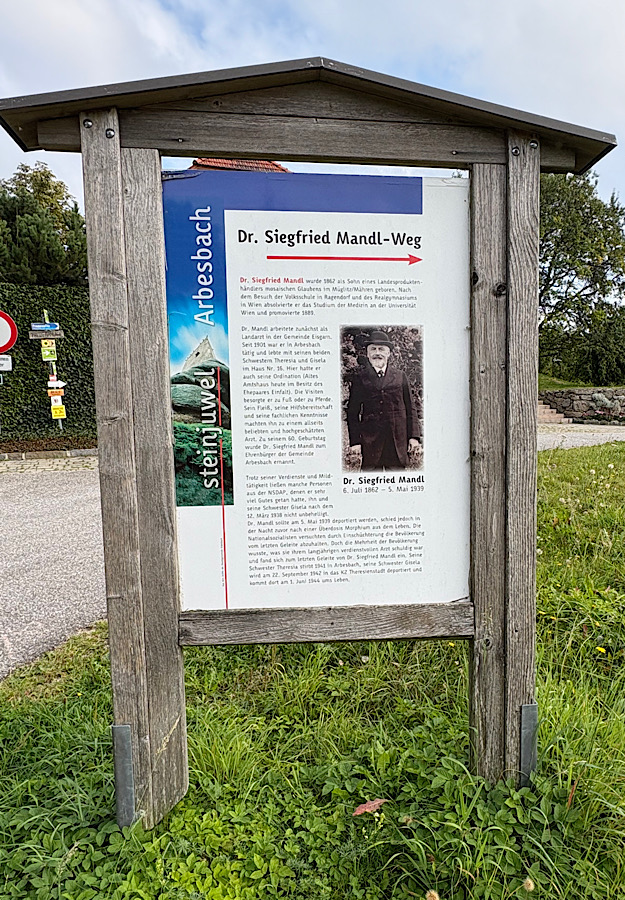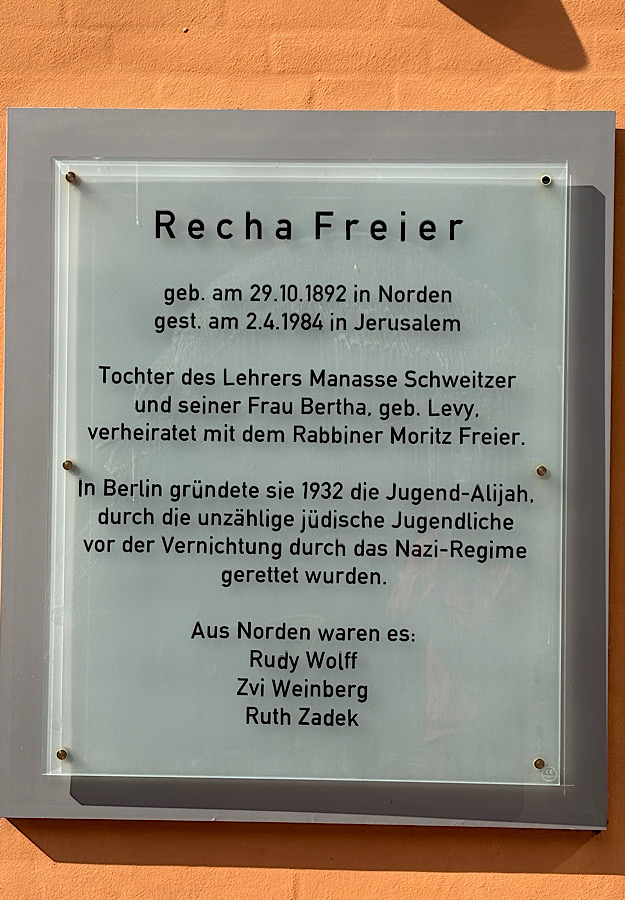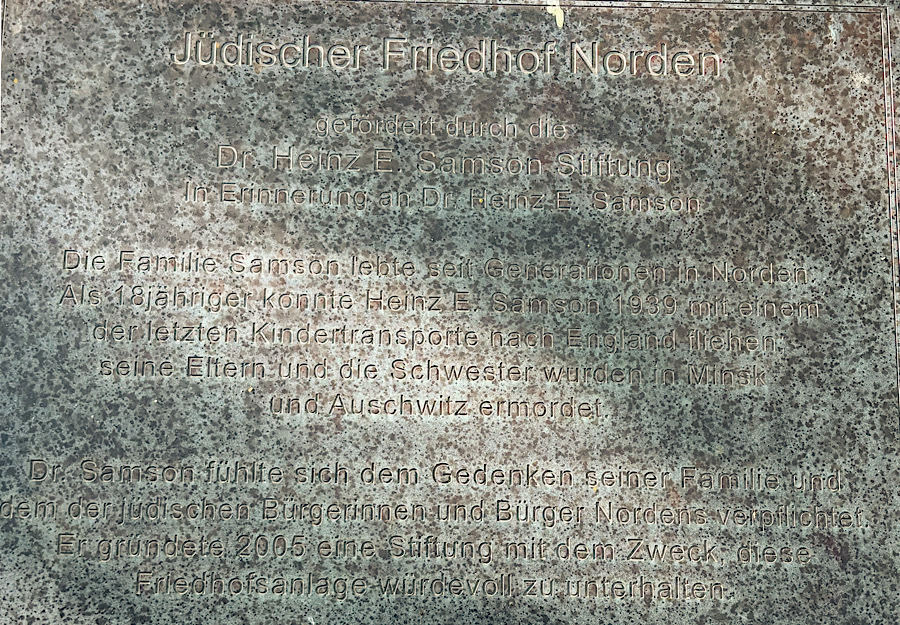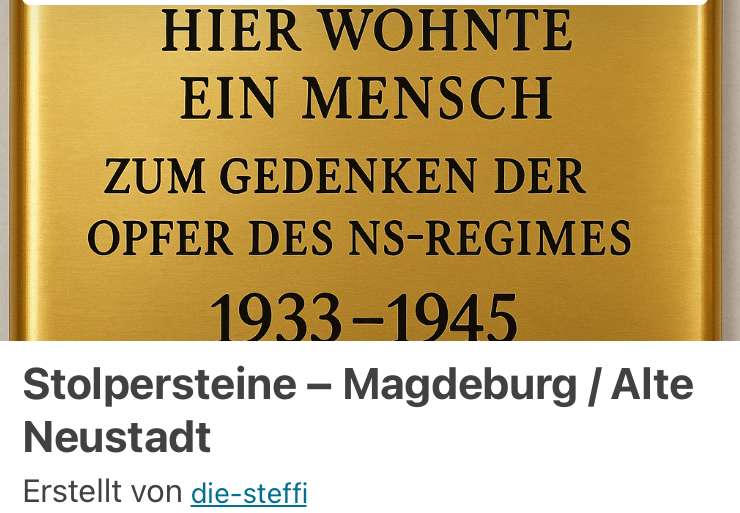Die Mehrheit der Wiener Fürsorgerinnen im Austrofaschismus und Nationalsozialismus verhielt sich regimetreu. Zahlreiche ihrer Kolleginnen wurden entrechtet, entlassen, zur Flucht gezwungen oder ermordet und nur eine Minderheit war im Widerstand aktiv. Anhand von 80 exemplarischen Biografien politisch und rassistisch verfolgter Fürsorgerinnen analysiert Irene Messingers Studie deren private und berufliche Netzwerke, institutionelle Ausschlussprozesse und Formen des Wissenstransfers ins Exil. Die portraitierten Frauen wirkten zuvor in Institutionen der Stadt Wien wie dem Jugendamt, sowie in privaten und konfessionellen Einrichtungen, darunter in der Fürsorge der IKG Wien oder in jüdischen Vereinen. Basierend auf erstmals ausgewerteten Quellen wie Personalakten, Zeitzeuginneninterviews, privaten Nachlässen, konnten zahlreiche Frauenbiografien rekonstruiert und historisch kontextualisiert werden. Somit wird die Berufsgeschichte der Sozialen Arbeit um bislang übersehene vor allem jüdische Akteurinnen ergänzt.