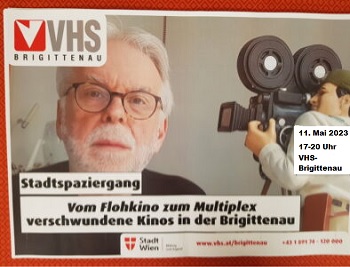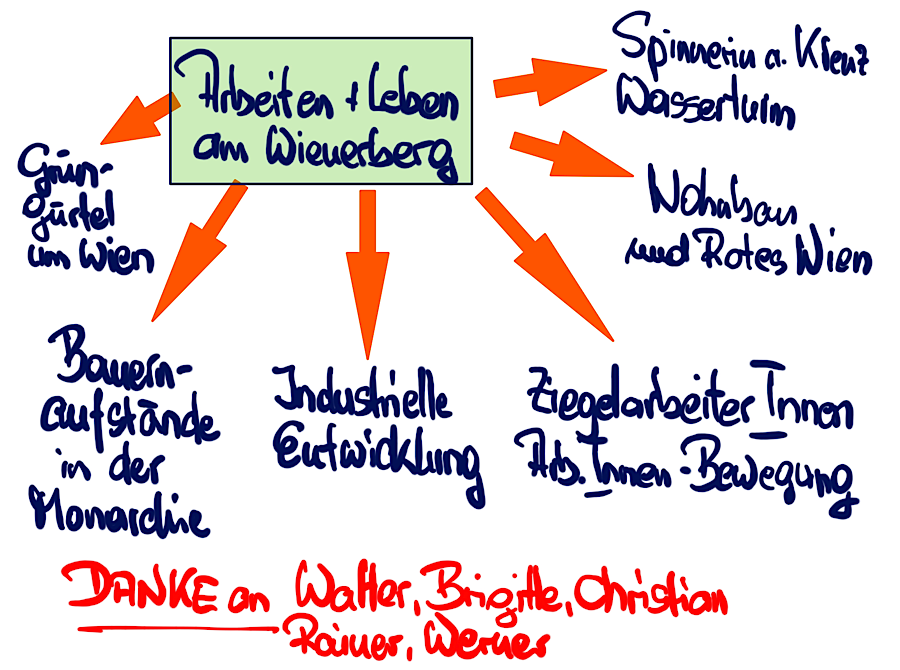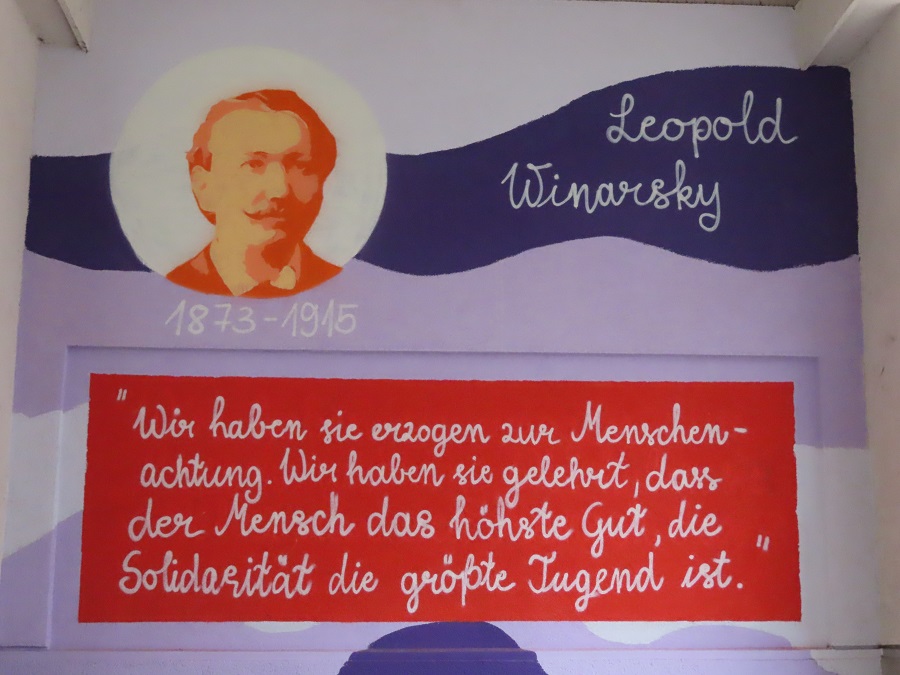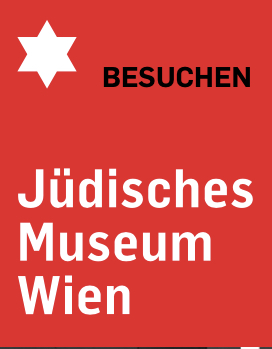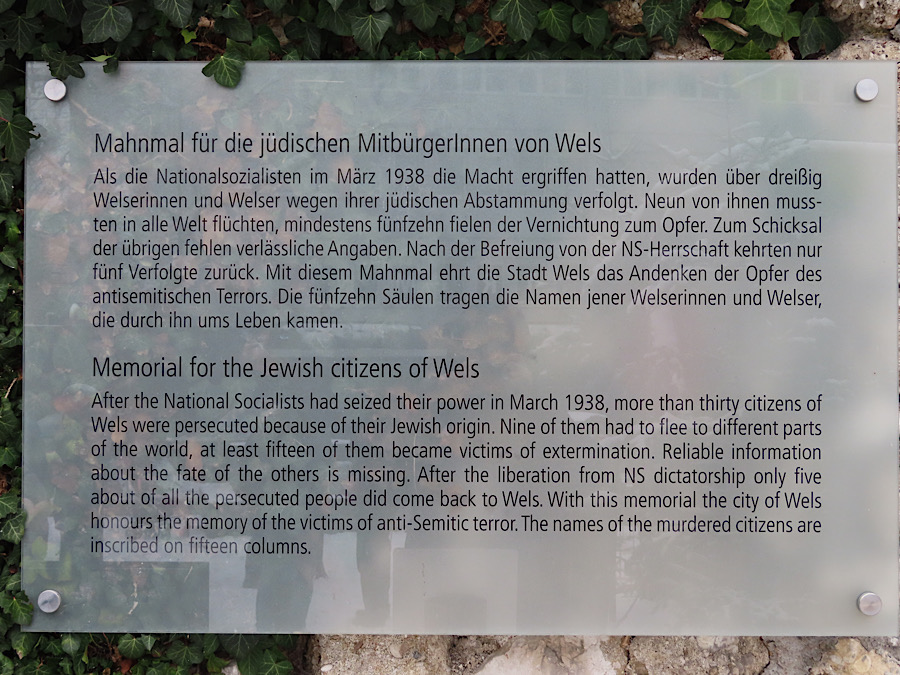Was bitte ist ein Frauenstreik?
Wie mobilisieren in der sogenannten Care-/Sorge-Arbeit?
Und was ist denn eigentlich der Frauenkampftag?
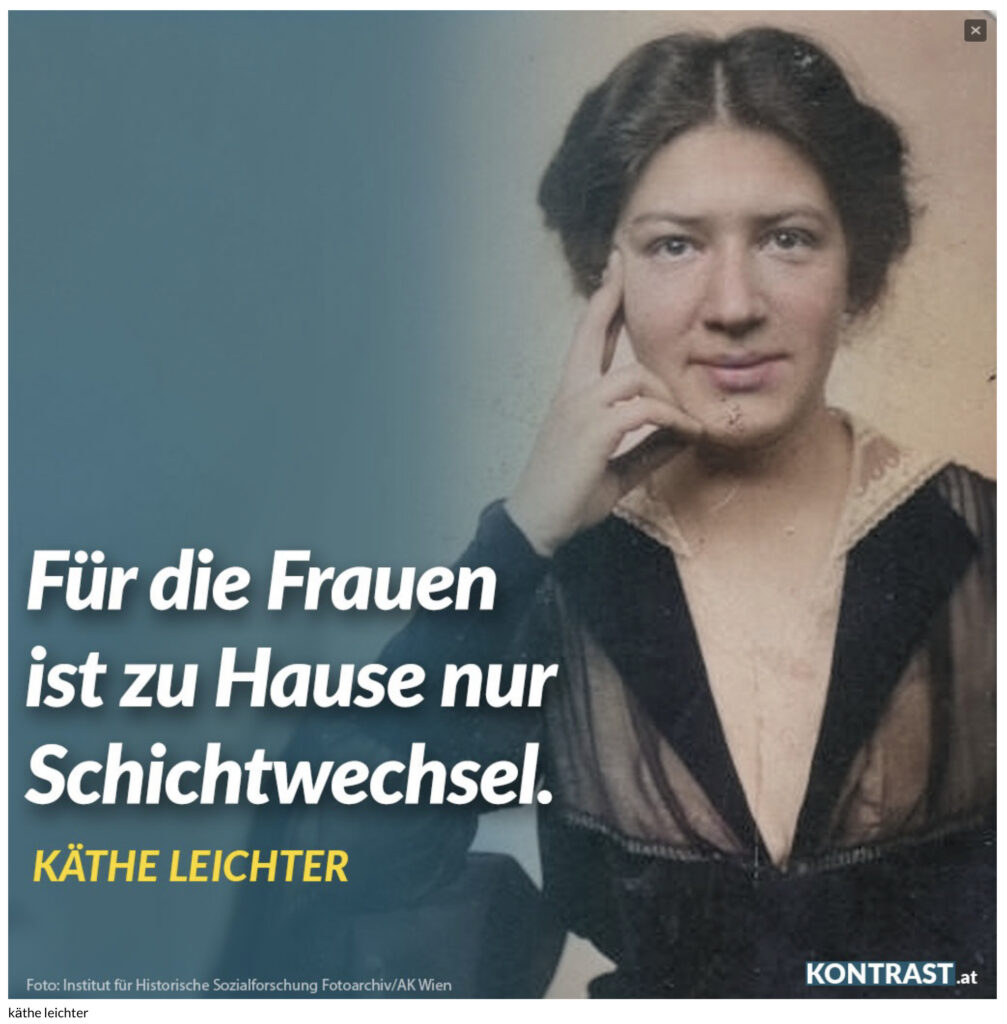
Zu sehen und hören gibt es internationale Beispiele von Frauenstreiks und Spielarten des Protests in systemrelevanten Berufen (wie z. B. dem Sozial- und Gesundheitsbereich). Außerdem kommen die Teilnehmer:innen zu Wort: Welche Erwartungen für die frauenpolitische Arbeit gibt es gegenüber der Interessengemeinschaft und der Gewerkschaft? Welche Ideen sollen die Gewerkschafterinnen für ihre Arbeit mitnehmen? Ein Online-Talk frei nach dem Motto: Wenn Frauen streiken, steht die Welt still!

Die GPA veranstaltet am 9. März von 18 bis 19 Uhr einen Online-Talk über weibliche Mobilisierung anlässlich des Internationalen Frauentages.
Online geben die Inputs
- Selma Schacht ist Diplomsozialarbeiterin und Vorsitzende der Interessengemeinschaft Social
- Henrike Kovacic ist Freizeitpädagogin, Betriebsrätin von Bildung im Mittelpunkt und Frauenbeauftragte der Interessengemeinschaft Social
- Julia Ilger ist Bundesfrauensekretärin der Gewerkschaft GPA
- Judith Reitstätter ist Branchen- und IG-Sekretärin der Gewerkschaft GPA