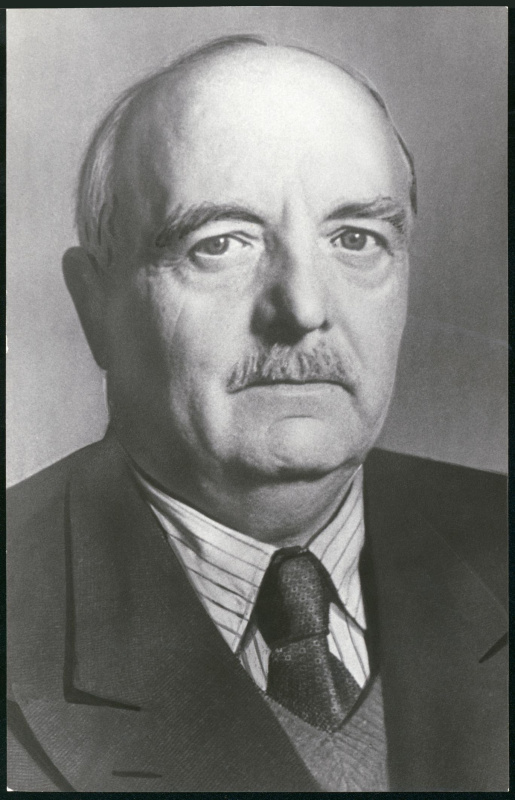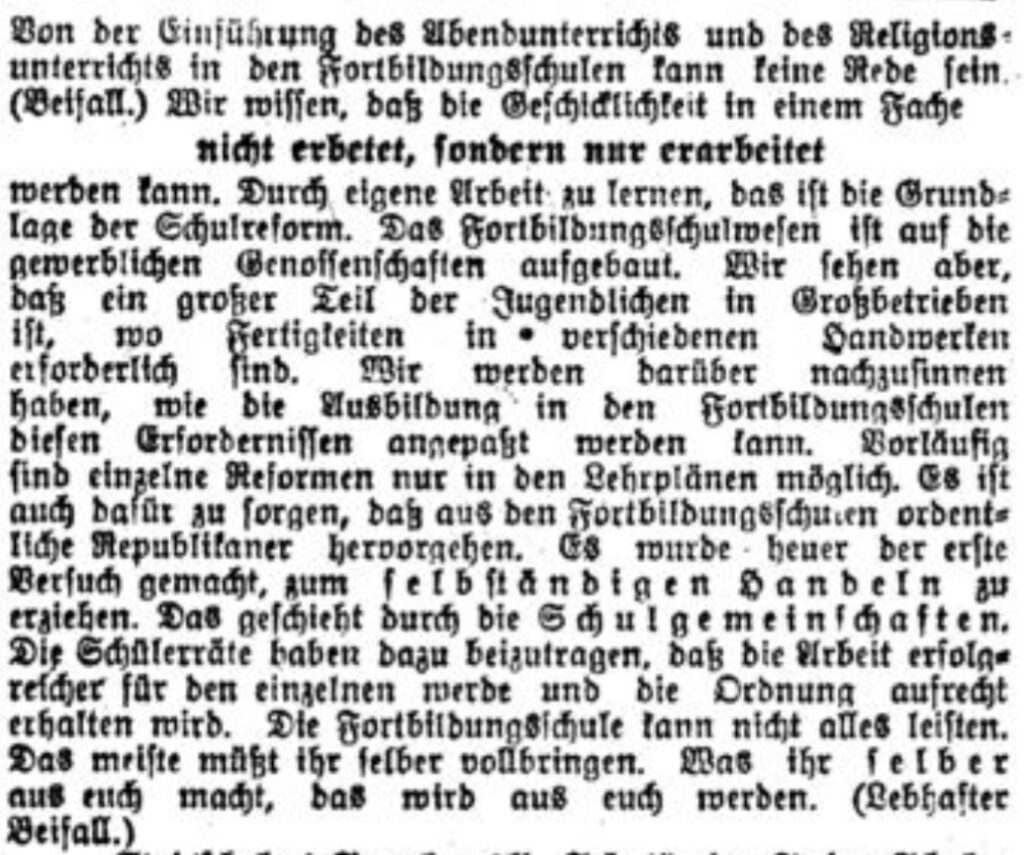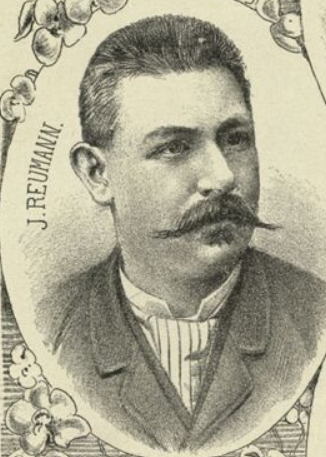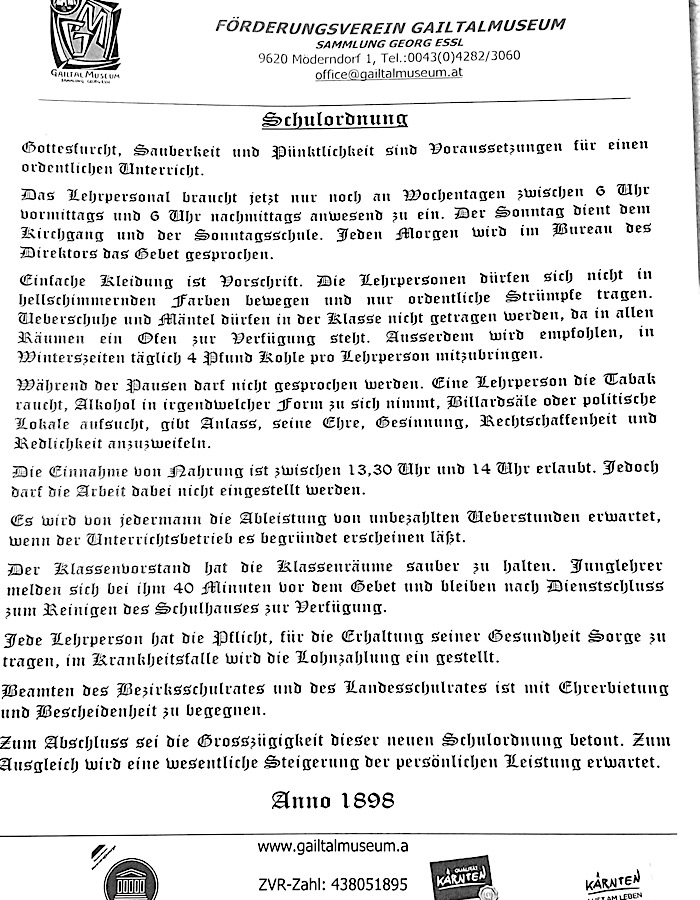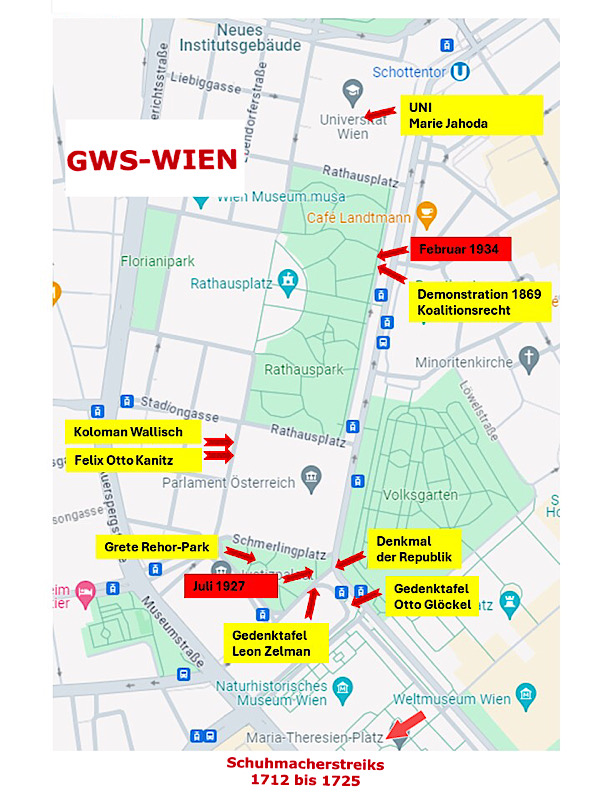Artikel zum Rundgang am Urnenhain – verfasst von Brigitte und Werner Drizhal
Stella Klein-Löw (geborene Herzig 28.1.1904, Przemýsl in Polen) wuchs in einer großbürgerlichen jüdischen Familie auf, die nach dem Ende der Monarchie verarmte. Ihre Eltern waren nach Wien gezogen, als sie noch Kleinkind war. Sie absolvierte hier die Volksschule und das Gymnasium. Im 13. Lebensjahr begann sie Nachhilfe zu geben und erhielt sich ihren Angaben zufolge von da an weitgehend selbst.1

Sie studierte an der Universität Wien Germanistik, klassische Philologie und Psychologie (Dr. phil. 1928); als wohlhabende jüdische “höhere Tochter” wurde sie Mitglied der sozialdemokratischen Arbeiterjugend und später der sozialdemokratischen Studentenbewegung. Sie hat im Mädchengymnasium Rahlgasse im Jahr 1923 maturiert und im Schuljahr 1931/32 nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums an der Universität Wien ihr Probejahr absolviert.
1939 musste sie wegen ihres jüdischen Glaubens und auf Grund der Bedrohung durch die
Nationalsozialisten nach langem Zögern nach Großbritannien flüchten, wo sie sich ihren Lebensunterhalt als Hausgehilfin verdienen musste. Ab 1941-1946 war sie als Lehrerin und Psychologin an einer Londoner Anstalt für schwer erziehbare Knaben tätig. 1946 kehrte sie mit ihrem zweiten Ehemann, dem Physiker Moses Löw (in erster Ehe war sie mit dem Arzt Hans Klein verheiratet, der jedoch 1933 Suizid beging), nach Wien zurück2. Viele andere Mitglieder ihrer Familie wurden in Vernichtungslagern ermordet.
Weiterlesen