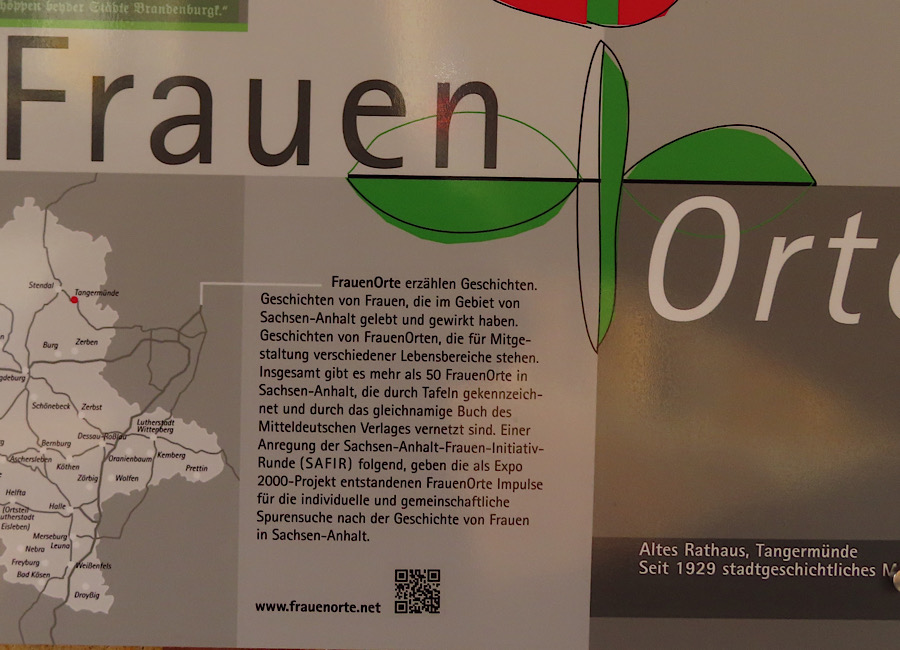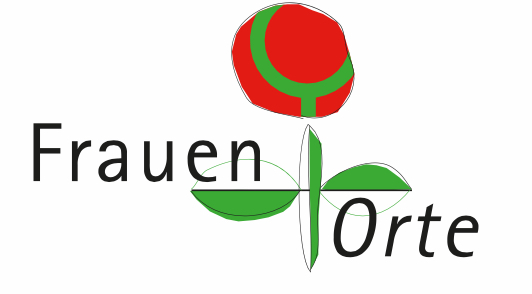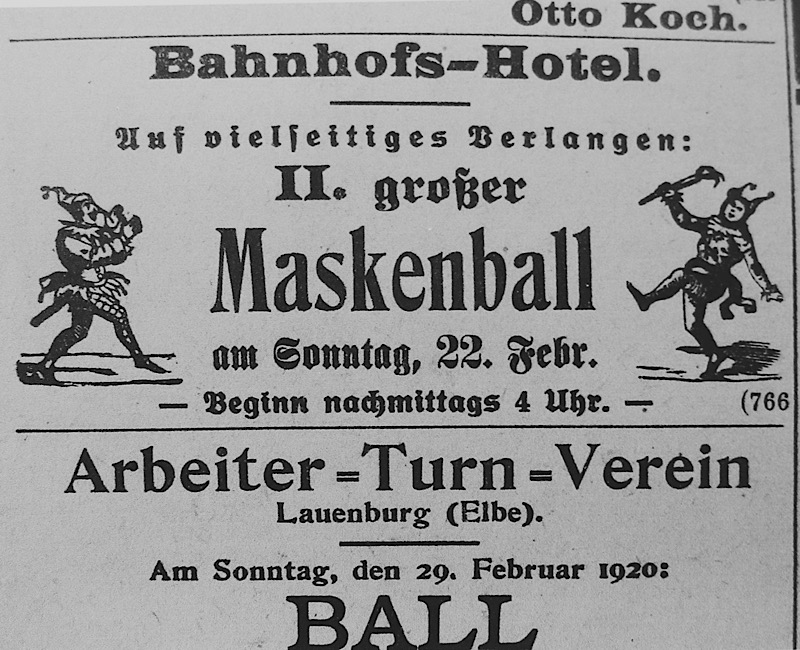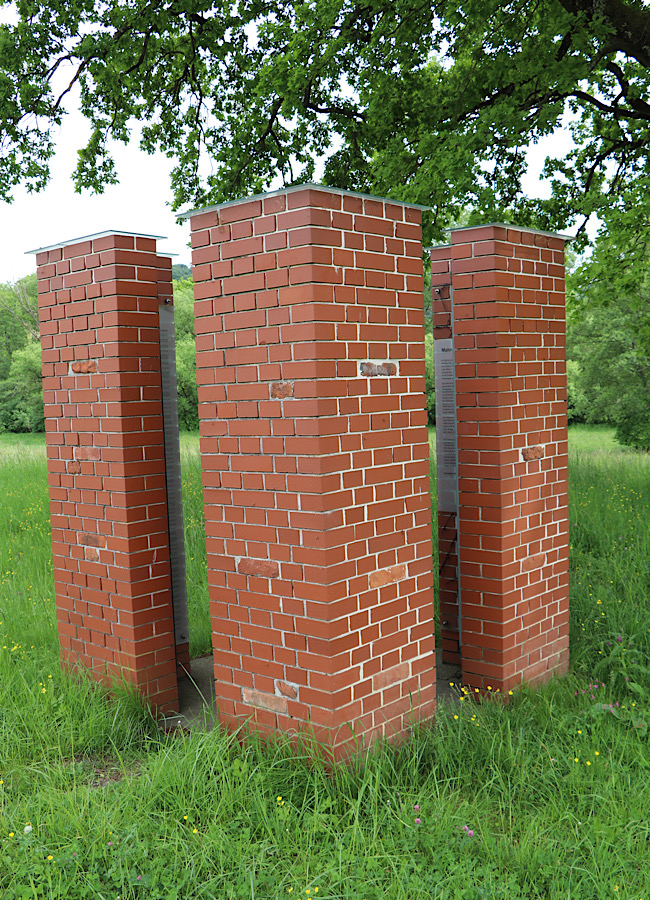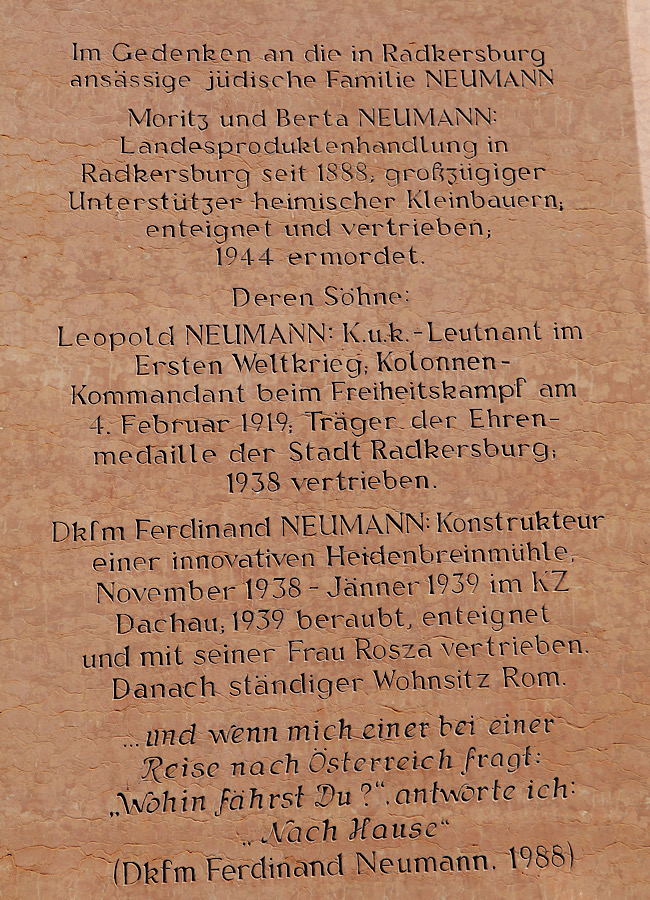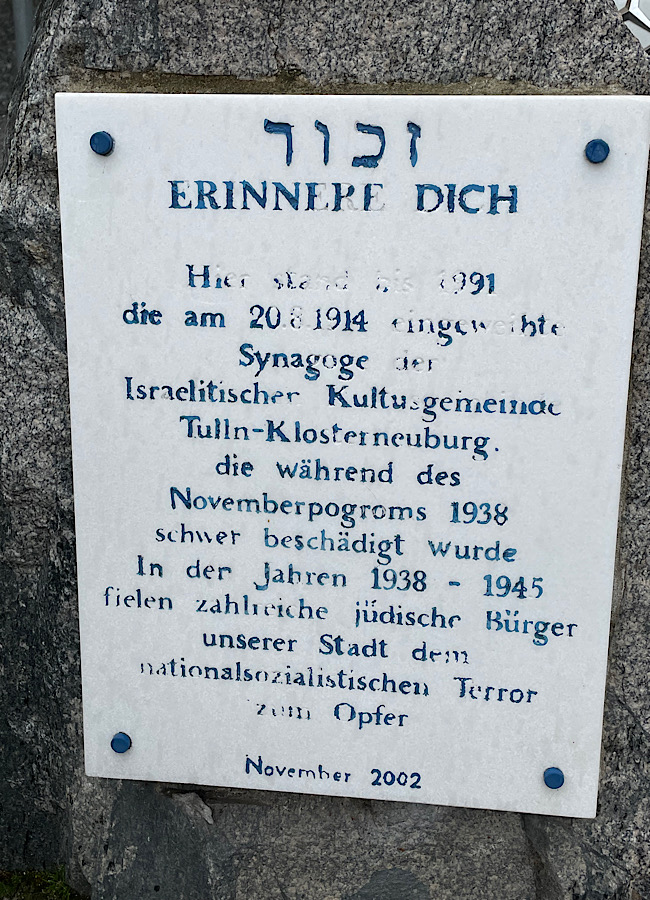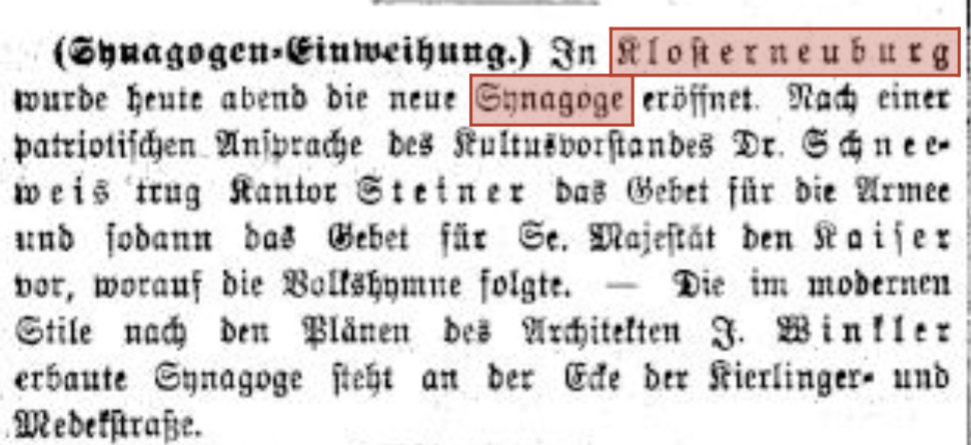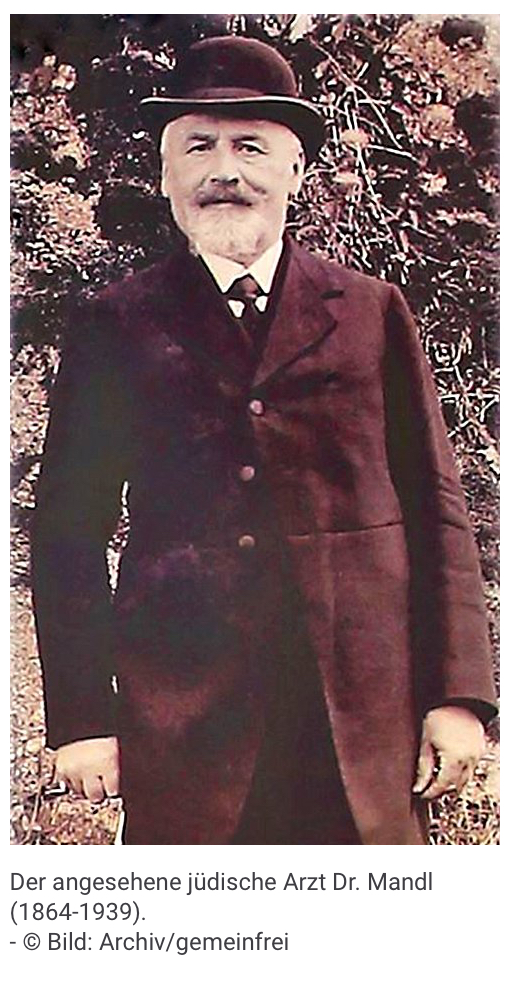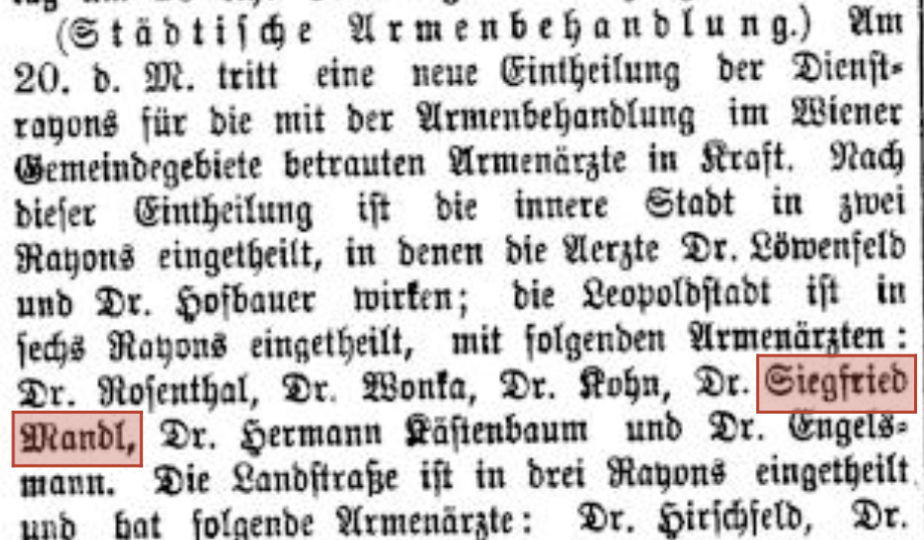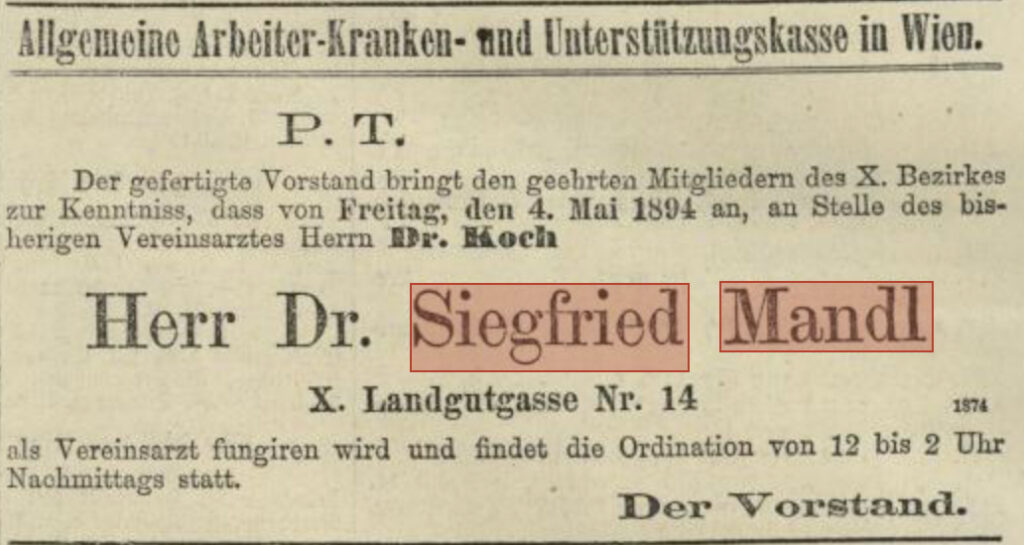Einige von uns nahmen den Fußweg vom Brandenburger Tor bis zum Treffpunkt in Kauf. Eine kleine Stärkung in einem ital. Cafe und dann trafen wir unseren Guide Stefan Szollhauser an der Ecke Weydingerstraße/Kleine Alexanderstraße beim “Karl-Liebknecht-Haus”.
„Kein Ostjude geht freiwillig nach Berlin“ schrieb Joseph Roth 1927 und meinte damit die vor der antisemitischen Gewalt in Osteuropa geflohenen Juden, die sich häufig im verarmten Scheunenviertel niederließen1.
Jüdische Migration in Berlin
Diejenigen, die sich auf den Weg nach Berlin machten, kamen in der Regel ursprünglich nicht um zu bleiben. Etliche jüdische Migrant/innen besaßen Durchreisevisa und sahen die Stadt als Durchgangsstation auf ihrem Weg weiter nach Westen. Viele jedoch strandeten hier, vor allem in der Gegend des ehemaligen Scheunenviertels. Im Jahr 1925 lebten 41.465 osteuropäische Jüdinnen und Juden in Berlin.2
Gekommen waren die osteuropäischen Migrant/innen seit den 1880er Jahren und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie waren auf der Flucht vor antisemitischen Pogromen, Zwangsrekrutierungen, russischer Sondergesetzgebung, Bürgerkrieg, bitterer Armut und Perspektivlosigkeit. Ab 1870 setzte eine jüdische Massenflucht aus dem Zarenreich ein. Die dortigen Pogrome waren religiös, sozial und zunehmend rassistisch motiviert, teilw. mit Unterstützung oder gar auf Geheiß des Staates3. Während des Ersten Weltkriegs wurde die jüdische Bevölkerung im besetzten Russisch-Polen mit der Aussicht auf Arbeit in der deutschen Rüstungsindustrie und der Aussicht auf Familiennachzug umworben; 30.000 Menschen folgten diesem Ruf nach Deutschland.